Ansprechpartner
Kreissportbund Wittenberg e.V.
Helene Milling
Tel: 03491 4594189
E-Mail: milling@ksb-wittenberg.de
Kinderschutz im Sport
Sport ist ein zentraler Bestandteil der kindlichen und jugendlichen Entwicklung. Er fördert nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch soziale Kompetenzen, Teamgeist und Selbstbewusstsein. Doch so wichtig und wertvoll Sport auch ist – er birgt auch Risiken. Fälle von psychischer, physischer und sexualisierter Gewalt im Sport. Für junge Menschen ist es schwierig über Missbrauchs- und Gewalterfahrungen im Sport zu reden und diese aufzudecken. Sportvereine stehen daher in der Verantwortung, aktiv zum Schutz von Kindern und Jugendlichen beizutragen. Es ist nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern eine dauerhafte gesellschaftliche Aufgabe.
Warum Kinderschutz im Sport wichtig ist
Kinder und Jugendliche sind in vielen Sportvereinen, Leistungszentren und Freizeiteinrichtungen aktiv. Dabei befinden sie sich oft in engen, vertrauensvollen Beziehungen zu Trainer*innen, Betreuer*innen und anderen Bezugspersonen. Diese Nähe kann positiv sein – sie kann aber auch ausgenutzt werden. Fehlende Aufsicht, Machtgefälle oder blinde Autoritätstreue machen es potenziellen Täter*innen leichter, Grenzen zu überschreiten. Umso wichtiger ist es, klare Schutzkonzepte zu etablieren, die präventiv wirken und Kinder und Jugendliche wirksam schützen.
Wichtige Ziele und Maßnahmen
1. Kinderschutzkonzept im Verein
Jeder Sportverein sollte ein individuelles Schutzkonzept entwickeln, das klare Verhaltensregeln, Meldewege und Präventionsmaßnahmen enthält. Es schafft Transparenz und gibt Kindern sowie Erwachsenen Sicherheit im Umgang mit schwierigen Situationen.
2. Schulungen und Sensibilisierung
Alle Personen mit Verantwortung im Sport - Trainer*innen, Übungsleiter*innen, Funktionär*innen – sollten regelmäßig in Kinderschutzthemen geschult werden. Dazu gehören Kenntnisse über Grenzverletzungen, sexualisierte Gewalt, aber auch der Umgang mit Verdachtsmomenten.
3. Erweiterte Führungszeugnisse
Die Unterzeichnung eines Ehrenkodexes sowie die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses sollte verpflichtend für alle Personen sein, die mit Minderjährigen arbeiten. Dies signalisiert eine klare Haltung und hilft, potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen.
4. Schaffung von Anlaufstellen und Beschwerdewegen
Kinder und Jugendliche brauchen sichere, vertrauliche Anlaufstellen, an die sie sich im Problemfall wenden können. Auch Eltern und andere Beteiligte müssen wissen, wohin sie sich bei Verdacht oder Unsicherheiten wenden können.
5. Partizipation von Kindern
Kinder und Jugendliche sollten in Schutzkonzepte eingebunden werden. Ihre Perspektive zählt – sie wissen oft selbst am besten, was sie brauchen, um sich sicher zu fühlen.
6. Kultur des Hinsehens statt Wegschauens
Eine offene Gesprächskultur, in der Themen wie Grenzverletzungen oder Machtmissbrauch nicht tabuisiert werden, ist essenziell. Schweigen schützt Täter*innen – aktives Hinsehen schützt Kinder.

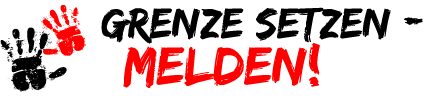







 by
by 